Gemeinschaftsschule konkret
In neun Beiträgen in unserer Zeitschrift Die Schule für alle Heft 2025/3 berichten Berliner Gemeinschaftsschulen über jeweils ein für ihre Arbeit wichtiges Thema. Interessant ist dabei, wie sie ihr Fokusthema in die übrige Arbeit einbetten:
Friedenauer Gemeinschaftsschule, Paul-Fürst-Gemeinschaftsschule, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule, Tesla-Schule, Freudberg-Gemeinschaftschule, Campus Hannah Höch, Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule, Fritz-Karsen-Schule
Alle Einblick(e)
Friedenauer Gemeinschaftsschule: Gemeinsam leben, gemeinsam lernen
Friedenauer Gemeinschaftsschule
Mit dem Start der Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen 2008 war von Beginn an deutlich, dass sich das Ziel inklusiven Lernens als wichtiges Element im Schulprogramm der Berliner Gemeinschaftsschulen etablieren sollte.
hier lesen
Gemeinsam leben, gemeinsam lernen
Friedenauer Gemeinschaftsschule
Daniel Dolležal
Die Integration von Kindern mit und ohne Behinderung hat in Berlin seit den 1970er Jahren Tradition. Im Laufe der Jahrzehnte folgten viele gute Beispiele gemeinsamen Lernens an Grund- und Oberschulen, aus denen vorrangig unterschiedlichste „Leuchtturmschulen“ hervorgegangen sind. Die Veränderung des Berliner Schulgesetzes 2004 führte erstmalig ein inklusives Lernen an Berliner Schulen ein, indem Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorrangig an Regelschulen unterrichtet werden sollten. Mit dem Start der Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen 2008 war von Beginn an deutlich, dass sich das Ziel inklusiven Lernens als wichtiges Element im Schulprogramm der Berliner Gemeinschaftsschulen etablieren sollte.
Auch an der Friedenauer Gemeinschaftsschule hat der Gemeinsame Unterricht seine Tradition. Gegründet wurde die Schule 2012 aus einer Fusion von zwei Grundschulen, sowie einer Haupt- und einer Realschule. Eine der zwei Grundschulen war die Uckermark-Schule, welche mit dem Modell der wohnortnahen Integration als zweite Integrationsschule in Berlin galt und 1992 aufgrund der damit verbundenen schulischen Arbeit den Deutschen Grundschulpreis erhielt. Der Geist des inklusiven Verständnisses ist geblieben und so lernen bis heute Kinder mit unterschiedlichen Begabungen, Herkünften, sozialen Voraussetzungen und Beeinträchtigungen von Klasse 1 bis 13 miteinander und voneinander. Ungefähr 15 % der Kinder haben einen besonderen oder sonderpädagogischen Förderbedarf.
Der Anspruch der Schule ist es, auf vielen Ebenen einer in der Gesellschaft vorzufindenden heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden. 2019 gewann die Schule aufgrund ihrer inklusiven Arbeit den Jakob-Muth-Preis für vorbildliche inklusive Schulen in Deutschland und gehörte 2024 zu den Preisträgern des Deutschen Schulpreises.
Inklusion ist ein Prozess, der sich auch an der Friedenauer Gemeinschaftsschule in 13 Jahren Schulentwicklung fortlaufend verändert. Dabei sind inklusive Prozesse durchgehend von Herausforderungen geprägt, die vor allem ein Werteverständnis und eine Haltung aller Pädagog*innen voraussetzen. Inklusion bedeutet auch, sich Herausforderungen zu stellen und den Mut zu haben, Wege zu gehen, die von Schwierigkeiten und Hindernissen geprägt sind. Inklusion bedeutet multiprofessionelles Arbeiten in Teams und die Bildung von Strukturen, die auf ein gemeinsames Lernen aller Kinder ausgerichtet sind.
Trotz der langjährigen Erfahrungen der damaligen Uckermark-Grundschule wurden integrative Strukturen zur Jahrtausendwende komplett abgetragen. Durch die zunächst stattfindende Fusion der zwei Grundschulen begann zunächst ein Neuaufbau. Der Schule ist es im ersten Schritt gelungen, eine Vielzahl von Sonderpädagog*innen einzustellen, die nicht nur sonderpädagogisch arbeiten, sondern auch als Fachlehrkräfte oder Klassenleitung tätig sind. Erzieher*innen werden fortlaufend zu Integrationserzieher*innen fortgebildet. Darüber hinaus ist ein multiprofessionelles Netzwerk von weiteren Fachkräften aus Therapeuten, Trägern der Jugendhilfe, Inklusionsassistent*innen und Sozialarbeiter*innen entstanden.
Inklusion beginnt schon mit dem Schulanfang. Anmeldegespräche dienen dazu, das Kind und die Eltern näher kennen zu lernen. Kooperationen mit umliegenden Kitas erleichtern die Kommunikation im Übergang und Schnuppertage laden ein, die Kompetenzen der Kinder kennen zu lernen. Gerade zu Schulbeginn ist es besonders wichtig die Stärken und Förderbedürfnisse zu identifizieren und für die Unterrichtsgestaltung einzuordnen.
In allen Jahrgängen arbeiten die Pädagog*innen in festen, multiprofessionellen Teams. Sie planen, gestalten und reflektieren den Unterricht und das pädagogische Handeln gemeinsam. Dafür sind feste Teamzeiten im Stundenplan verankert. Gemeinsames Lernen bedeutet auch als Kind in einer Gemeinschaft zu sein. Das jahrgangsübergreifende Lernen von 1–3, 4–6 und 7–9 ermöglicht, dass sich die Kinder immer wieder sehen. Übergänge können in sanfter Form stattfinden. Durch einen gezielten Personaleinsatz der Lehrkräfte in den jeweiligen Partnerklassen und durch Übergangssitzungen werden individuelle Bedarfe und Förderziele entsprechend weitergetragen.
Generell werden Fördermaßnahmen gemeinsam in sogenannten Förderplankonferenzen mit allen Pädagog*innen abgestimmt, die wiederum als Grundlage von zweimal jährlich stattfindenden Bilanz- und Zielgesprächen dienen. Sonderpädagog*innen übernehmen in der Förderplanung eine moderierende Rolle.
Inklusive Förderung baut sich in der Friedenauer Gemeinschaftsschule vorrangig über drei Säulen auf. Die erste Säule ist die Differenzierung innerhalb des jahrgangsübergreifenden Unterrichts. Jedes Kind lernt dort, wo es steht. Die Begleitung des Lernprozesses wird dabei über Logbücher und die Erstellung individueller Arbeitsmaterialien unterstützt. Multiprofessionelle Teams begleiten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag.
Die zweite Säule konzentriert sich auf diverse Förder- und Forderangebote, die es in einer Vielzahl während des Unterrichts und außerhalb der Unterrichtszeit gibt. Beispielhaft dafür sind Angebote zu Lese-Rechtschreibförderung, Rechenschwäche, lebenspraktischem Unterricht, Lesehund, Sprachfördergruppen, sowie Begabungskurse mit stufenbezogenen und stufenübergreifenden Angeboten. Das Projekt Übergang gilt zudem als ein besonderes Förderangebot für Kinder mit sehr herausragendem Verhalten in Kooperation mit der Jugendhilfe. Ziel soll sein, in einer Kleingruppe von vier Kindern und einem sehr strukturierten und ritualisierten Fördersetting, die Kinder im System der Schule zu halten. Darüber hinaus bietet die Schule auch Raum und Möglichkeiten zur therapeutischen Förderung während des Unterrichts, um damit auch eine Entlastung für Kinder und deren Erziehungsberechtigte zu geben.
Die dritte und sehr zentrale Säule sind Beratungsstrukturen innerhalb der Schule. Neben den Teamsitzungen, Förderplankonferenzen und diversen Beratungsangeboten durch externe Unterstützer und der Schulsozialarbeit bildet das Fallteam ein besonderes Kernelement. Dazu setzt sich ein Beratungsgremium, bestehend aus Leitungsmitgliedern der Schule, der Schulpsychologie und der beratenden Sonderpädagogin, einmal im Monat zusammen, um einen „Fall“ zu besprechen. Hierzu werden die Klassenleitung, die zuständige Sonderpädagogin und die Bezugserzieherin ausgeplant. Ziel ist es dabei, sich gegenseitig umfassend über das Kind auszutauschen, Thesen und Ideen zu entwickeln, um am Ende eine gemeinsame Strategie zur weiteren Förderung und zu weiteren Schritten zu verarbeiten. Die Ergebnisse haben in all den Jahren gezeigt, dass das inklusive Verständnis geschärft und die Verantwortung für das Kind auf mehrere Schultern verteilt wird.
Der Weg zu einer inklusiven Schule ist möglich, wenn es im Rahmen der Schulentwicklung gelingt, ein Werteverständnis gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention zu verankern und dies wie ein Dach über alle Schulentwicklungsprozesse stets im Blick zu behalten. Alle Kinder profitieren von einer Schule für alle, in der es darum geht, dass jedes Kind als Individuum seiner eigenen Lern- und Leistungsentwicklung gesehen wird. Gerade die Grundelemente der Berliner Gemeinschaftsschulen tragen in ihrer elementaren Schulstruktur dazu bei, dass inklusives Lernen vom Schulanfang bis zum Schulabschluss gelingen kann. Die Friedenauer Gemeinschaftsschule ist dafür ein gutes Beispiel. Es zeigt jedoch auch, dass inklusive Schulentwicklung Zeit braucht und den Willen dies in kleinen Schritten umzusetzen.
Weitere Informationen:
https://friedenauer-gemeinschaftsschule.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule: Ganztag
Paula Fürst-Schule
Die Gemeinschaftsschule als Schule für alle ist nicht denkbar ohne ein umfassendes Konzept erweiterter Lernzeiten, Räume und dem abgestimmten Zusammenwirken multiprofessionell zusammengesetzter Teams – kurz der Ganztagsschule!
hier lesen
Ganztag
Paula-Fürst-Schule
Karen Beecken
Die Gemeinschaftsschule als Schule für alle ist nicht denkbar ohne ein umfassendes Konzept erweiterter Lernzeiten, Räume und dem abgestimmten Zusammenwirken multiprofessionell zusammengesetzter Teams – kurz der Ganztagsschule!
Die Paula-Fürst-Schule, die Gemeinschaftsschule in Charlottenburg-Wilmersdorf, ermöglicht daher das Lernen über den ganzen Tag von der ersten bis zur zehnten Jahrgangsstufe im gebundenen Ganztagsbetrieb. Bei der Ausgestaltung leitet uns das übergeordnete Entwicklungsziel des individualisierten Lernens in der Gemeinschaft sowohl was die Unterrichtsphasen als auch die außerunterrichtlichen Phasen betrifft und insbesondere dort, wo sich diese beiden Phasen ergänzen und/oder überlagern.
Dazu gehört z. B. unsere Schülerbibliothek „Seitenreich“, die mit Schüler:innen organisiert zum Teil in den Unterricht, das Wahlpflichtprojekt, einbezogen ist, als auch im Freizeit- und AG-Bereich Angebote für Schüler:innen bietet und sie zur aktiven Mitarbeit einlädt. In ähnlicher Weise verbindet das Projekt „Paulas Special Kitchen“ den Unterrichtsbereich mit dem ganztägigen Bildungsbereich in Form einer Schüler:innenfirma, die ebenfalls vielfältige Lerngelegenheiten schafft und zu den übergeordneten Zielen der inklusiven Berliner Ganztagsschule (1) wie etwa der Lebensweltorientierung sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Bei beiden Angeboten ist die Verzahnung von Räumen, Zeit und Bildungselementen sowie der Kooperation zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren so geglückt, dass Lernen über den ganzen Tag für die teilnehmenden Schüler:innen ermöglicht wird.
In den vergangenen 1,5 Jahren haben wir uns innerhalb der Schulgemeinschaft gefragt, wie wir die Angebote im gebundenen Ganztag insbesondere in der Sekundarstufe gemäß den Qualitätsstandards einer inklusiven Schule weiterentwickeln können. Dazu hat sich eine Steuergruppe, die Schulentwicklungsgruppe „Ganztag“ bestehend aus der Koordinatorin für den Ganztag, der Mittelstufenleitung, einem Erzieher aus dem Sekundarstufenbereich sowie einem Elternteil zusammengefunden, um zunächst Entwicklungsbereiche zu identifizieren. Diese fanden sich vor allem in den Qualitätsbereichen Zeit, Raum und Bildungselemente. Um wiederum den derzeitigen Stand in diesen drei Bereichen genauer zu erfassen wurden über einen standardisierten Fragebogen, den das Institut für Schulqualität des Landes Berlin (ISQ) (2) angebunden an die Qualitätsstandards entworfen hat, die Beteiligten der Schulgemeinschaft (Eltern, Schüler:innen, Erzieher:innen, Lehrkräfte) eingeladen an der Evaluation teilzunehmen. Aus den Ergebnissen der Befragung entwickelte die Steuergruppe wiederum einen Fokus, der den thematischen Schwerpunkt eines Workshops bildete: „Das Mittagsband als abwechslungsreiche Pause gestalten – anregen, auspowern, abhängen“.
Zu diesem Workshop waren neben der Schulentwicklungsgruppe „Ganztag“ vor allem Schüler:innen eingeladen, in einem partizipativen Prozess die im Fokus angesprochene Zeit des Tages nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und damit auch beizutragen zu dem im Handlungsrahmen für Schulqualität festgeschriebenen Merkmal „Schulzufriedenheit und Außenwirkung“ (3). Hier bietet die Ganztagsschule als Lebensort für Kinder und Jugendliche besondere Möglichkeiten des ganzheitlichen Lernens unter besonderer Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse, die als Voraussetzung auch für erfolgreiche schulische Leistungen erscheinen. Durch die aktive Gestaltung des Tages übernehmen insbesondere die Jugendlichen Verantwortung für ihr eigenes Umfeld, erfahren Selbstwirksamkeit und tragen selbst dazu bei, den Ort, an dem sie einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringen, in ihrem Sinne positiv zu gestalten und gern zur Schule zu gehen.
Im Workshop wurde zunächst ein Ideenspeicher erstellt, aus dessen Elementen dann in einer weiteren Arbeitsphase konkrete Angebote entwickelt wurden, die mindestens einem der drei Bereiche anregen, auspowern oder abhängen zugeordnet werden können. Die konkreten Planungsinhalte wurden auf Projektkarten festgehalten und mit konkreten Verabredungen in die weitere Planungsphase überführt. Die neuen Angebote können so z. T. schon zu Beginn des neuen Schuljahres im September umgesetzt werden. Dazu gehört z. B. die Eröffnung eines Aufenthaltsraumes im Mensa-Bereich, in dem Schüler:innen gemeinsam mit einer Studentin für Soziale Arbeit anderen Schüler:innen die Möglichkeit zum Aufenthalt, für Austausch und/oder Spiele bieten. Da die Aufenthaltsmöglichkeiten für die Schüler:innen der Sek I im Vergleich zu den Schüler:innen in der Grundstufe relativ beschränkt waren, bietet sich hier ein Angebot, das unmittelbar anknüpft an die von Schüler:innen formulierten Bedürfnissen aus der Befragung.
Ein weiteres konkret geplantes neues Angebot umfasst die Parallelnutzung eines Klassenraums auch als Meditationsraum, der von Schüler:innen selbstorganisiert betrieben wird. Da hier noch die nötigen Anschaffungen zum Verstauen von Kissen und Matten (bereits vorhanden) getätigt werden müssen, bedarf es noch mehr Zeit für die Umsetzung. Aber auch in der Planungsphase sind die Jugendlichen bereits beteiligt und werden so in der Gestaltung der neuen Aktivität bereits aktiv eingebunden sein.
In unserer Entwicklungsarbeit erleben wir es als zentral, dass neben – leider nicht durchgängig – verlässlich zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen für den Ganztag auch eine klare personelle Zuständigkeit für die Steuerung der Entwicklungsprozesse gegeben ist. Dies erreichen wir derzeit mit einer Lehrkraft, die die Funktion einer Ganztagskoordination kommissarisch übernimmt sowie der sechsmal im Jahr tagenden entsprechenden Schulentwicklungsgruppe. Sehr hilfreich in diesen Prozessen ist die Unterstützung der Service-Agentur Ganztag in Berlin(4), die den zuvor beschriebenen Entwicklungsprozess mit externer Moderation und inhaltlichen Impulsen effektiv begleitet hat.
Im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung werden wir nun als nächstes den Kernbereich Zeit in den Fokus nehmen und die derzeitige Tages- und Wochenrhythmisierung im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Variablen weiterentwickeln. Eine besondere Herausforderung stellt dabei dar, dass die Paula-Fürst-Schule an zwei Standorten verortet ist, die knapp einen Kilometer voneinander entfernt sind. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Umsetzung einer inklusiven Ganztagsbeschulung stets vor Ort und mit einem hohen Maß an Partizipation aller Akteur:innen erfolgen muss, damit sie gelingt.
---
(1) Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM): Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule, Ludwigsfelde 2021, S. 12.
(2) www.isq.berlin
(3) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Forschung (Hrsg.): Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin, Berlin 2013, S. 45
(4) https://www.sag-berlin.de/
Weitere Informationen:
https://paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Lernwerkstat
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ (Galileo Galilei)
Ausgehend von diesem humanistischen Leitgedanken entwickelte sich an der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule in Berlin-Moabit eine besondere Form des Lernens: die Lernwerkstatt.
hier lesen
Lernwerkstatt
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
Julian Hallmann, Carolin Arlt-Gleim
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ (Galileo Galilei)
Ausgehend von diesem humanistischen Leitgedanken entwickelte sich an der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule in Berlin-Moabit eine besondere Form des Lernens: die Lernwerkstatt. Im Schuljahr 2009/10 wurde ihr pädagogisches Konzept fest im Schulcurriculum (SchiC) verankert – als Ausdruck unseres reformpädagogischen Selbstverständnisses und als Antwort auf die Frage, wie Lernen gelingen kann, wenn es von innen heraus geschieht.
Ziel der Lernwerkstatt ist es, das intrinsisch motivierte Lernen einer jeden Schüler*in zu fördern. Dabei steht nicht die reine Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern die Entfaltung individueller Interessen und Potenziale. Ein weites, thematisch offenes Oberthema bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Lernenden eigene Fragestellungen entwickeln. Sie planen ihre Arbeitsschritte selbstständig – unterstützt durch Kompetenz- und Methodenkarten, die ihnen helfen, ihren Lernprozess zu strukturieren und zu reflektieren.
Die Lernwerkstatt ist ein Raum des forschenden Lernens, in dem Kulturtechniken eingeübt, Eigenverantwortung gestärkt und Selbstwirksamkeit erfahrbar wird. Sie ist ein lebendiger Ausdruck unserer Überzeugung, dass nachhaltiges Lernen dort entsteht, wo junge Menschen sich als aktive Gestalter*innen ihres Bildungsweges erleben dürfen.
Durch die feste Verankerung im Stundenplan (vier Wochenstunden, jeweils mit beiden Klassenlehrkräften) wird der Lernwerkstatt an der Heinrich-von-Stephan-Schule ausreichend Raum gewährt, um die o. g. Ziele adäquat verwirklichen zu können. Aus diesem Stellenwert entsteht natürlich auch eine Verpflichtung: Im Laufe der letzten Jahre kam es zu regelmäßigen Evaluationen und es kristallisierten sich wiederkehrende Kritikpunkte aus unserem Kollegium heraus. Um der reformpädagogischen Ausrichtung der Lernwerkstatt auch zukünftig gerecht werden zu können, bildete sich 2023 eine Projektgruppe aus vier Klassen. Die Lernwerkstatt sollte mit einigen Verbesserungen neu aufgestellt werden.
Die erste davon war flurübergreifendes Lernen. In unserer Mittelstufe sind auf einem Flur jeweils zwei jahrgangsübergreifende Klassen der Stufe J (Jahrgang 7 und 8) sowie zwei Klassen der Stufe M (Jahrgang 9 und 10). Die Idee war nun, die SuS dieser Klassen auch in bestimmten Phasen zusammenarbeiten zu lassen und die Klassenräume z. B. in Themenbereiche (z.B. GeWi, NaWi, Kunst und Deutsch) zu unterteilen, welchen sich die SuS klassenübergreifend zuordnen können. Grundvoraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass alle Klassen des Flures zeitgleich Lernwerkstatt haben und entsprechende Fachkolleg:innen zur Verfügung stehen. Mittlerweile wurde dies bereits umgesetzt. Die flurübergreifende Lernwerkstatt bietet große Chancen, den SuS abwechslungsreiches, individuelles und vor allem eigenverantwortliches Lernen anbieten zu können. Es ergeben sich aber auch naheliegende Herausforderungen, weshalb wir vor allem hieran weiterhin arbeiten.
Ein weiterer Diskussionspunkt waren die Lernprodukte. Oftmals lief das Arbeiten in der Lernwerkstatt auf eine Online-Recherche mit anschließender PowerPoint-Präsentation hinaus.
Es fehlte auch eine Abstimmung auf unsere Oberstufenprofile. SuS können zwischen drei verschiedenen Profilen wählen: Politik/Englisch, Deutsch/Kunst und Biologie/Geographie. Daher macht es natürlich Sinn, den SuS die jeweiligen Profile schon während der Mittelstufe näher zu bringen. Vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich mangelt es oft an Interesse der SuS, was sich auch in sehr niedrigen Anmeldungen für die NaWi-Wahlpflichtkurse in der Mittelstufe zeigt.
Beiden genannten kritischen Befunden wollen wir nun mit der Design Thinking Methode begegnen. Beim Design Thinking geht es kurz gesagt darum, für eine Problemstellung Lösungsansätze zu entwickeln und dabei wie ein Unternehmen bzw. “Start-Up” vorzugehen. Kooperatives Lernen und Kompetenzorientierung stehen im Vordergrund. Hierzu gehört vor allem, dass sich die SuS in andere Personen hineinversetzen (“Nutzerperspektive erfassen”), um Lösungen für echte Menschen mit realen Problemen zu erstellen. Dafür werden u. a. Interviews mit betroffenen Personengruppen geführt und ausgewertet, Ideen gesammelt, eine Lösung/Prototyp (z. B. Herstellen realer Produkte, Ideen für eine neue App, Planung und Umsetzung von Aktionstagen innerhalb und außerhalb der Schule, Podcasts, Videos, Theaterstücke…) erstellt und diese anhand von Feedback durch eine weitere Befragung der Personengruppen erneut überarbeitet. Jede SuS-Gruppe kann dabei eigene Lösungen für unterschiedliche Personengruppen erstellen und z. B. Interviews mit diesen organisieren, u. a. waren das in diesem Schuljahr Fahrradfahrer oder Fußgänger, aber auch Polizei, Müllentsorgung oder Verkäufer*innen im Einzelhandel. Entwickelte Lösungen wurden dann in der Aula den Eltern der SuS präsentiert, auch auf dem Sommerfest können SuS an eigenen Ständen ihr Lernprodukt vorstellen.
Konkret haben die Projektklassen nun jahrgangsübergreifend im Schuljahr 2023/24 am Thema “Zukunft” (naturwissenschaftlicher Schwerpunkt) und 2024/25 am Thema “Ungerechtigkeiten” (gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt) gearbeitet. Ebenfalls in diesem Schuljahr haben weitere Klassen der Mittelstufe das im letzten Jahr erprobte Thema “Zukunft” bearbeitet. Mittelfristig werden insgesamt vier Themenbereiche und Unterrichtsreihen entwickelt und erprobt, sodass später alle SuS während der Mittelstufe abwechselnd von den Klassen 7–10 alle Themen bearbeiten. So wird gleichzeitig fächerübergreifendes Lernen ermöglicht.
In unserer Grundstufe werden die SuS bereits in den Klassen 1–4 im Rahmen des Sachunterrichts auf die Lernwerkstatt und das forschende Lernen vorbereitet. In den Jahrgängen 5/6 wird das Fach Lernwerkstatt regulär durch halbjährlich zu wählende Schwerpunkte unterrichtet, die an die Oberstufenprofile angelehnt sind, allerdings im Wahlpflichtbereich ohne Benotung. Mittelfristig sollen die Unterrichtsreihen zwischen Grundstufe und Mittelstufe weiter verzahnt werden, hier wurden erste Schritte bereits unternommen.
Die letzten beiden Jahre haben nun gezeigt, dass der Design Thinking-Ansatz große Chancen für die Motivation und das eigenständige, individuelle Lernen der SuS bietet. An diesem Ansatz werden wir festhalten, wenn nun die nächsten Unterrichtsreihen geplant und die bisherigen überarbeitet werden. Ergebnisse und Erfahrungen werden regelmäßig durch den Austausch der Klassenleitungen evaluiert. Als größte Herausforderung stellte sich das flurübergreifende Lernen heraus; sowohl, was Vorbereitung (z. B. differenziertes Unterrichtsmaterial für 4 Jahrgangsstufen) und Einsatzplanung angeht (Bereitstellen von verschiedenen Fachkolleg:innen), aber auch die konkrete Umsetzung im Unterricht (Unterstützungsangebote für lernschwächere SuS, Prävention von möglicher Frustration, gleichzeitige Arbeitsphasen für 4 Klassen).
Ganz wichtig: Das “Scheitern” ist beim Design Thinking ausdrücklich erlaubt. Die Ziele sind: Fördern von Eigenständigkeit, Selbstwirksamkeit und Flexibilität im Umgang mit Problemen in lebensnahen Situationen.
Weitere Informationen:
https://hvs-schule-berlin.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Tesla-Schule: Projektraumfest
Tesla-Schule
Heute ist ein besonderer Tag an der Tesla-Gemeinschaftsschule in Berlin-Pankow: Das vierte und letzte Projektraumfest des Schuljahres steht bevor. Heute öffnen alle Jahrgangsstufen ihre Türen zu einem lebendigen Marktplatz des Wissens.
hier lesen
Projektraumfest
Tesla-Schule
Ilayda Kinzel, Maja Wessolowski
Heute ist ein besonderer Tag an der Tesla-Gemeinschaftsschule in Berlin-Pankow: Das vierte und letzte Projektraumfest des Schuljahres steht bevor. Heute öffnen alle Jahrgangsstufen ihre Türen zu einem lebendigen Marktplatz des Wissens. Dazu haben die Schüler:innen der 1. bis 10. Klassen ihre Räume vorbereitet, um ihre Projekte anschaulich und Neugierde weckend auszustellen.
Eltern, Pädagog:innen und Schüler:innen aller Jahrgänge sind eingeladen, die Räume zu betreten, die Projekte zu bestaunen und Fragen zu stellen. In den Fluren und Klassenräumen der Schule herrscht reges Treiben. Während des Projektraumfestes übernehmen die Schüler:innen kurze Präsentationen, in denen sie ihre Arbeiten vorstellen und erklären, was sie gelernt haben. Besonders spannend sind dabei die Mitmachstationen: Hier können die Besucher:innen selbst aktiv werden, Experimente durchführen, kleine Konstruktionen bauen oder kreative Aufgaben lösen. Das Projektraumfest ist ein Ereignis, das die gesamte Tesla-Schulgemeinschaft eine lebendige Feier des Lernens und der Kreativität erleben lässt.
Gedanken zum Projektunterricht
Der Projektgedanke ist in der deutschen Schulpädagogik seit den reformpädagogischen Bewegungen ein unverzichtbarer Bestandteil, der auf den Einflüssen bedeutender Pädagogen wie Comenius, Rousseau und Pestalozzi basiert (vgl. Fridrich 1994, S. 8ff.). Aus den unterschiedlichen Wurzeln sind im Laufe der Zeit verschiedene Konzepte (z.B. die offene Projektarbeit) entstanden (vgl. Fridrich 2001, S. 357). Dabei wird zumeist der Projektunterricht als eine im Stundenplan fest integrierte Lernform verstanden, die mehrmals pro Woche zu festen Zeiten ihren Ort findet (vgl. ebd./ Kesting 2022, S. 2). Im Stundenplan der Tesla-Gemeinschaftsschule ist der Projektunterricht mit zwei Wochenstunden (á 60 Minuten) in den Stundenplänen der Jahrgangsstufen 1–10 fest verankert. Da es sich jedoch um kein eigenständiges Fach im Fächerkanon handelt, wird seine Durchführung zeitlich aus dem Kontingent anderer Fächer gedeckt wie bspw. dem Sachunterricht in den Jahrgangsstufen 1–4.
In der Summe ist damit das Projektlernen viel mehr als nur eine willkommene Abwechslung (vgl. Fridrich 2001, S. 356f.). Der Anspruch besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler anstelle eines rein kopflastigen Unterrichts „… [vernetzt,] exemplarisch-entdeckend, selbstständig-handelnd, im Team … ganzheitlich lernen.“ (bm:bwk 2001, S. 65) (vgl. Fridrich 2001, S. 356f./ Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern 2023, S. 5). Diese Ganzheitlichkeit wird durch eine planvolle, selbstorganisierte, interdisziplinäre und kooperative Auseinandersetzung mit Fragestellungen und Problemen aus dem Lebens- und Interessenbereich der Schülerinnen und Schüler eingelöst (vgl. Fridrich 1994, S. 26/ Universität Koblenz 2018, S. 1). Zugleich und keinesfalls zu unterschlagen, werden dabei Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Teamfähigkeit, Planungs-, Gestaltungs- sowie Kommunikations- und Sozialkompetenzen praktisch und intrinsisch gefördert (vgl. bm:bwk 2001, S. 44/ S. 61/ Schweder 2009, S. 55).
Planung des Projektunterrichts
Die Planung des Projektunterrichts zeichnet sich fortführend durch eine Phasenstruktur aus, die sich wie folgt gestaltet (vgl. Schweder 2009, S. 31): Zunächst steht 1. die Projektidee an, bei der ein komplexes Problem oder eine Aufgabe als Ausgangspunkt dient (vgl. ebd.). Darauf folgt 2. die Projektdefinition, in der die eigentliche Aufgaben- oder Fragestellung selbst erarbeitet wird (vgl. ebd.). In 3. der Planungsphase wird die Organisation der Teamarbeit gestaltet, während 4. die Projektdurchführung die eigentliche Zusammenarbeit im Team bedeutet, bei der diskutiert, Denkweisen und Zwischenergebnisse zusammengeführt, der Projektfortschritt reflektiert sowie Entscheidungen getroffen werden (vgl. ebd.). Zum Schluss folgen 5. der Projektabschluss, bei dem das fertige Projekt präsentiert wird und 6. die Projektevaluation, bei der die Projektergebnisse und Lernfortschritte überprüft werden (vgl. ebd./ bm:bwk 2001, S. 11). Diese Phasenstruktur ist als Orientierungshilfe für die Praxis zu verstehen, da die einzelnen Phasen, die den didaktischen Prinzipien der Schüler-, Wirklichkeits- und Produktorientierung folgen, stets an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden sollten (vgl. ebd., S. 61/ Schweder 2009, S. 31).
So erarbeiten zu Beginn des Schuljahres die Jahrgangsteams der Tesla-Gemeinschaftsschule die Projektideen bzw. ‑themen auf Grundlage des Schulprofils und des Rahmenlehrplans Sachunterricht bzw. der Gesellschafts- und Naturwissenschaften und legen diese quartalsweise fest. Die Offenheit bzw. Konkretisierung der festgelegten Themenfelder hängt dabei von der jeweiligen Jahrgangsstufe ab. Das bedeutet: Je älter die Jahrgangsstufe, desto mehr Selbstbestimmung haben die Teslaner:innen bei der Gestaltung ihrer Projekte. In der Regel erfolgt dann nach einem kurzen Themeneinstieg die Bildung von Arbeitsgruppen, die sich anhand der vorgegebenen Bearbeitungszeit und des festgelegten Lernziels einen Arbeitsplan erstellen und die Aufgaben untereinander verteilen. Bei diesem Arbeitsprozess steht die Lehrkraft in einer beratenden Funktion zur Seite. Nach Ablauf der Bearbeitungsphase präsentieren die Arbeitsgruppen ihre erarbeiteten Lernprodukte anhand vorher festgelegter Kriterien und reflektieren gemeinsam ihren Arbeitsprozess. Abschließend werden die Ergebnisse im Rahmen des Projektraumfests vierteljährig ausgestellt und gebührend gewürdigt.
Fazit
Was bleibt, wenn zum Ende des Projektraumfestes sich die Türen der Klassen schließen, die Projektprodukte zusammengeräumt werden und die Eltern allmählich den Tesla-Campus verlassen? Zuallererst viele stolze Gesichter über das Präsentierte und eine Ahnung davon, dass gerade Wissen und Lernen in einer besonderen Form präsentiert und vermittelt wurde. Vielleicht aber eine Ermutigung auch dafür, Unterricht noch mehr zu öffnen, noch stärker fächerverbindend und damit ganzheitlicher zu arbeiten, das entdeckende Lernen in den Fokus zu stellen, Erfolge zu feiern und Schule somit zu einem besonderen Ort der Anerkennung und Selbstwirksamkeit werden zu lassen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass das Projektraumfest ein Spiegelbild sein könnte, um in allen Fächern projektorientiertes Lernen dauerhaft zu etablieren.
Weitere Informationen:
https://www.tesla-schule.de/
Quellen
(1) Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern (2023): Projektunterricht im 9. Schuljahr – Umsetzungshilfe für Schulleitungen und Lehrpersonen. Online: URL: https://www.sz.ch/public/upload/assets/82552/Projektunterricht_Umsetzungshilfe_fuer_Schulleitungen_und_Lehrpersonen.pdf?fp=3 [Letzter Zugriff: 30.06.2025]
(2) Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk) (Hrsg.) (2001): Grundsatzerlass zum Projektunterricht. Tipps zur Umsetzung. Online: URL: https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?rex_media_type=pubshop_download&rex_media_file=052_pu_tipps.pdf [Letzter Zugriff: 30.06.2025]
(3) Fridrich, Christian (1994): Chancen und Grenzen des Projektlernens an österreichischen Schulen aus heutiger Sicht. In: Anzengruber, Grete/ Hajek, Anton/ Kassar, Beatrix/ Wildmoser, Christa (Hrsg.): Projektunterricht. Chancen und Grenzen des Projektlernens. Wien: Jugend & Volk, S.7-30
(4) Fridrich, Christian (2001): Projektunterricht, projektartige Unterrichtsformen. In: Sitte, Wolfgang/ Wohlschlägl, Helmut (Hrsg.): Beiträge zur Didaktik des "Geographie- und Wirtschaftskunde"-Unterrichts. Bd. 16. Wien: Universität Wien, S.356-378
(5) Kesting, Lena Maria (2022): Warum Projektlernen? Praxisratgeber für Scrum und agiles Projektlernen im Unterricht. Online: URL: https://www.scolix.de/media/ntx/aol/sample/10708DA3_Musterseite.pdf?srsltid=AfmBOooMN9eV6qpsmCTGFn6OKDjJ9aSDLmZaBfbaj27y7wGaE8nzd2NZ [Letzter Zugriff: 30.06.2025]
(6) Schweder, Sabine (2009): Neue Chancen für Projektlernen. SCHOLA-21. Online: URL: https://sag-sh.de/storage/123/Arbeitshilfe-12----Neue-Chancen-f%C3%BCr-Projektlernen.pdf [Letzter Zugriff: 30.06.2025]
(7) Universität Koblenz (2018): Materialien und Methoden V: Offene Lernumgebungen gestalten. Online: URL: https://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Pflichtmodule_18-19/31_Materialien_und_Methoden_V_-_03.12.2018/04_Projektbegriff.pdf [Letzter Zugriff: 30.06.2025]
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Freudberg-Gemeinschaftsschule: Jahrgangsübergreifendes Lernen
Freudberg-Gemeinschaftsschule
Schüler:innen in jahrgangsgleiche Gruppen zu sortieren und anzunehmen, dass sie deshalb gleich alt und leistungshomogen sind, ist ein Irrglaube – und findet außerhalb der Schule und im weiteren Leben kaum statt.
hier lesen
Jahrgangsübergreifendes Lernen
Freudberg-Gemeinschaftsschule
Ann-Katrin Schwindt
Wenn ich gefragt werde, was das jahrgangsübergreifende Lernen (JÜL) für unsere Schule bedeutet, antworte ich meist: Es ist mehr als eine Form der Unterrichtsorganisation. Es ist Ausdruck unseres Verständnisses von Bildung – individuell, gemeinschaftlich, entwicklungsorientiert. Schüler:innen in jahrgangsgleiche Gruppen zu sortieren und anzunehmen, dass sie deshalb gleich alt und leistungshomogen sind, ist ein Irrglaube – und findet außerhalb der Schule und im weiteren Leben kaum statt.
An der Freudberg-Gemeinschaftsschule in Berlin-Wilmersdorf leben wir seit unserer Gründung 2016 ein jahrgangsübergreifendes Modell. In der Grundschule lernen unsere Kinder in Gruppen der Jahrgänge 1–3 und 4–6, in der Sekundarstufe in Jahrgängen 7–9. Nur in Klasse 10 arbeiten wir immer jahrgangsbezogen, um gezielt auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Auch außerhalb des Unterrichts setzen wir auf Durchmischung: In Arbeitsgemeinschaften arbeiten Schüler:innen aus den Jahrgängen 7–10 gemeinsam und unsere Flure sind nicht nach Jahrgangsstufen gegliedert. So entstehen echte Begegnungen: Große helfen Kleinen bei Vorträgen, lesen im Morgenkreis vor oder kicken gemeinsam auf dem Schulhof. Wenn ein Zweitklässler morgens einem Zehntklässler einen schönen Schultag wünscht, ist das für uns gelebte Gemeinschaft.
Eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir täglich machen, ist: Kinder lernen nicht nur Inhalte – sie lernen miteinander und voneinander. Ältere Schüler:innen übernehmen Verantwortung für jüngere, helfen bei Aufgaben, erklären Regeln oder trösten bei Unsicherheiten. Diese Beziehungserfahrungen fördern nicht nur die soziale Entwicklung, sie stärken auch die Selbstwahrnehmung und Empathie.
Eine besondere Stärke des jahrgangsübergreifenden Lernens zeigt sich bei uns in einem Aspekt, der selten im Zentrum steht, aber für die kindliche Entwicklung entscheidend ist: Beziehungsstabilität bei gleichzeitiger individueller Lernbewegung. Denn anders als im klassischen Jahrgangssystem müssen Kinder bei uns nicht die Klasse wechseln, wenn sie in einem Fach noch mehr Zeit brauchen oder in einem anderen beschleunigt lernen. Sie bleiben in ihrer vertrauten Lernumgebung, mit bekannten Bezugspersonen und Freund:innen, während sich ihre individuellen Lernpfade weiter entfalten. Das gibt Sicherheit – und ermöglicht Fortschritt ohne sozialen Bruch. Ein Schüler kann z. B. ein Jahr länger in der Jahrgangsstufe 1–3 bleiben, ohne dass er sein vertrautes Team oder seine Umgebung verliert. Genauso kann ein Kind aus der Jahrgangsstufe 2 bereits mit den Kindern aus Stufe 3 an herausfordernden Projekten arbeiten. Diese durchlässige Struktur macht nicht nur das Lernen flexibler, sondern vor allem auch menschlicher. Aus pädagogischer Sicht ist das ein zentraler Vorteil: Beziehungen zu Pädagog:innen und Peers bleiben erhalten – gerade in sensiblen Entwicklungsphasen, in denen Kinder und Jugendliche Bindung und Kontinuität dringend brauchen.
Unsere Entscheidung für JüL war auch wissenschaftlich begründet. Die wissenschaftliche Begleitung der Berliner Gemeinschaftsschulen zeigt, dass diese Schulform Bildungserfolg vom sozialen Hintergrund entkoppeln kann. In der Evaluation der Universität Hamburg heißt es: „Erstaunliche Lernzuwächse in allen Kompetenzbereichen – unabhängig von der sozialen Herkunft“ (1). Das bestärkt uns: Unsere Schule steht für Vielfalt und Chancengleichheit. JüL ist dafür ein zentrales Instrument.
Ein oft geäußerter Vorbehalt gegenüber JüL ist die Sorge vor Überforderung der Lehrkräfte durch heterogene Lerngruppen. Unsere Erfahrung zeigt jedoch: Gerade diese Heterogenität ermöglicht echte Individualisierung – wenn sie professionell gestaltet wird. Hierfür arbeiten wir nicht nur innerhalb der Klassenteams in möglichst multiprofessionellen Teams, sondern auch in den Jahrgangs- und Fachteams. Jeden Mittwoch treffen sich alle Pädagog:innen, um gemeinsam unterrichtsrelevante Themen zu besprechen, sich über Schüler:innen zu beraten und gemeinsam Unterrichtsmaterial vorzubereiten, auszuwerten und zu überarbeiten. Es ist essenziell, dass die Pädagog:innen sich nachhaltig organisieren und kooperieren. Doppelsteckungen in den Stunden, gemeinsame Planungszeit, kollegiale Hospitationen – wir arbeiten als Gemeinschaft an unserer Unterrichtsqualität. Teamarbeit ist unser tägliches Mittel, um heterogenem Kontext mit hoher didaktischer Professionalität zu begegnen.
Binnendifferenzierung ist für uns selbstverständlich: Mit Wochenplänen, individuellem forschendem Lernen und persönlichem Feedback schaffen wir strukturierte Freiräume, in denen jedes Kind im eigenen Tempo lernen kann. Wir setzen auf eine Balance aus individueller Arbeit und gemeinsamer Verbindlichkeit. Jedes Kind hat eigene Ziele – und wir stellen uns als Pädagog:innen die Frage: Was braucht dieses Kind zum Lernen? Das erfordert Beobachtung, Analyse und Dokumentation.
JÜL fördert auch die Selbstständigkeit. Gerade im forschenden Lernen sehen wir, wie Kinder eigene Fragen entwickeln, recherchieren, präsentieren. Es geht nicht um Noten, sondern um Erkenntnis, Methodenkompetenz und Kooperation. Kinder der ersten Klasse lernen mit älteren gemeinsam – profitieren von deren Fähigkeiten und wachsen an ihren Aufgaben.
Oft werden wir gefragt: Wie wirkt sich jahrgangsübergreifender Unterricht auf die Leistungen aus? Unsere Antwort: Differenziert – aber keineswegs negativ. Internationale Studien zeigen, dass JüL mindestens gleich gute Leistungen ermöglicht – in manchen Bereichen, etwa im Lesen oder in der Problemlösung, sogar bessere.
Natürlich bringt dieses Modell auch Herausforderungen mit sich: Jedes Schuljahr verändert sich ein Drittel der Lerngruppe. Die Ältesten verlassen die Stufe, neue Jüngere rücken nach. Das bedeutet: Jedes Team muss jährlich als Lerngemeinschaft neu zusammenwachsen. Dieses hohe Maß an Bewegung erfordert von uns – und von den Kindern – viel Beziehungsarbeit: Rituale des Ankommens, Räume des Kennenlernens, eine bewusst gelebte Willkommenskultur. Besonders in den ersten Wochen eines neuen Schuljahres investieren wir daher gezielt in Teambildung und soziale Orientierung. Klassenrat, Patenschaften und individuelle Gespräche helfen dabei, Rollen zu finden und Zugehörigkeit zu stiften. Wir wissen: Diese Übergänge sind sensibel. Aber sie bringen auch eine große Chance mit sich – nämlich die, soziale Offenheit und Integration aktiv zu fördern. Jüngere erleben, dass sie bald selbst zu den „Großen“ gehören. Ältere lernen, Verantwortung abzugeben und neue Mitschüler:innen aufzunehmen. So wachsen alle – in ihrer sozialen Reife und in ihrem Rollenverständnis.
Jahrgangsübergreifendes Lernen ist für uns also keine organisatorische Notlösung, sondern eine konsequente Antwort auf die Frage: Wie wollen wir Bildung in einer pluralen, dynamischen Gesellschaft gestalten?
Wir erleben täglich, wie unsere Schüler:innen Verantwortung übernehmen, sich gegenseitig stärken, eigenständig denken und handeln. Wir sehen, dass individuelle Förderung möglich ist – auch in heterogenen Gruppen. Und wir wissen, dass dies nur gelingt, wenn wir als Schulgemeinschaft gemeinsam daran arbeiten.
(1) https://ggg-web.de/be-bildung-politik/560/175
Weitere Informationen:
https://www.freudbergschule.org/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Campus Hannah Höch: Wie Vertrauen den Campus stärken kann
Campus Hannah Höch
Als einzige Gemeinschaftsschule im Berliner Bezirk Reinickendorf hat sich der Campus Hannah Höch bewusst der Begegnung mit Offenheit verschrieben, die schon im Campusbegriff angelegt ist.
hier lesen
Wie Vertrauen den Campus stärken kann
Campus Hannah Höch
Linda Helbig, Beat Seemann, Patricia Soler, Clara Wengler
Als einzige Gemeinschaftsschule im Berliner Bezirk Reinickendorf hat sich der Campus Hannah Höch bewusst der Begegnung mit Offenheit verschrieben, die schon im Campusbegriff angelegt ist: Ein Campus, das ist der lateinischen Wortbedeutung nach ein offenes Feld. Dieses offene Feld zeigt sich im Äußeren auf fast drei Hektar Gelände, gelegen mitten im Märkischen Viertel Berlins. In diesem strukturell herausfordernden Sozialraum ist der Campus eine Schule für alle, wobei in inklusiven jahrgangsübergreifenden Lerngruppen ganztägig gelernt und gelebt wird.
Im Äußeren zeigt sich die Offenheit des Campus nicht nur durch die Weite des Geländes, sondern auch in den Gebäuden selbst, etwa in den bis zu 400 qm umfassenden offenen Lernetagen, die durch das Herausreißen von Wänden der klassischen 70er-Jahre-Bauten bereits zu Beginn der 2000er Jahre entstanden sind. Wo Offenheit herrscht, wird Gestaltung möglich, ganz im Sinne der im OECD-Lernkompass 2030 vielbeschworenen Student Agency. Schüler:innen werden zu handelnden Akteuren ihres Lernens und Lebens am Campus – dies fördert und fordert Vertrauen.
Schüler:innen gestalten individuelle und gemeinsame Lernwege
In allen Stufen bearbeiten die Lernenden einen Teil von Aufgaben in festgelegten individuellen Lernzeiten an – je nach Entwicklungsstand und Bedürfnis – frei gewählten Arbeitsorten: Wo kann ich gerade lernen, was tut mir gut? Boden, Einzeltisch, Ecke, im Klassenraum, im Flur, ganz nah bei der Lehrkraft für schnelle Rückmeldung oder weiter weg, zum Beispiel in der Bibliothek? Insbesondere durch die jahrgangsübergreifende Zusammensetzung der Lerngruppen wird ein möglichst konkurrenzfreier Raum für das gemeinsame Lernen im eigenen Tempo geschaffen.
Durch die individuelle Passung der Aufgaben und die damit verbundene Erfolgswahrscheinlichkeit erlangen die Kinder Vertrauen in ihr eigenes Lernhandeln und erleben sich als selbstwirksam. Zugleich wird das Selbstvertrauen durch das Sichtbarmachen der Lernzuwächse, zum Beispiel im Logbuch und auch in den Kreisgesprächen gestärkt: „Ich bin gut, so wie ich bin!“ Gelingt die Passung, wächst auch das Vertrauen der Kinder in die Lehrkraft, dass die Aufgaben sinnvoll sind und kein sinnloses Üben für alle Kinder im Gleichschritt erfolgt. Die notwendigen Selbststeuerungsfähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sind jedoch höchst individuell und auch im Tages- und Wochenverlauf unterschiedlich, so dass die Lehrkraft Kinder, bei denen die Fortschritte stagnieren, enger begleitet, für Sicherheit und Struktur sorgt und die Reflexion anregt: Brauchst du Ruhe? Hilft es, wenn du alleine bist? Brauchst du die Nähe der Lehrkraft? Konntest du schon feststellen, dass du neben einem Kind ganz besonders gut lernen konntest?
Die vielfältigen Notwendigkeiten der Unterstützung von individualisierten Lernprozessen bringen das System da an Grenzen, wo eine Lehrkraft 26 Kinder allein begleitet, die mitunter sehr komplexe Hilfebedarfe mit sich bringen. Hier ist die multiprofessionelle Zusammenarbeit mit z. B. Erzieher:innen und Sonderpädagog:innen maßgeblich für das Gelingen des Ansatzes. Aber auch das jahrgangsübergreifende Lernen mit Lernpatenschaften und Helfersystemen stellt eine Ressource für das Gelingen dar.
Schüler:innen gestalten ihre Leistungsbeurteilung
Die Logbücher, wie sie mittlerweile an vielen Schulen eingesetzt werden, bieten den verbindlichen Raum für die Lerndokumentation und Lernreflexion. Wir führen halbjährlich Bilanz- und Zielgespräche mit den Kindern und ihren Eltern durch. Grundlage dieser Gespräche ist eine umfassende Selbsteinschätzung der Schüler:innen zu ihrer eigenen Lern- und Leistungsentwicklung sowie besondere Lernprodukte. Mit Blick auf eine regelmäßige Leistungsbeurteilung verzichten wir bis zur Jahrgangsstufe 6 auf die Vergabe von Noten und stellen den Kindern am Ende jedes Schuljahres ein kompetenzorientiertes Indikatorenzeugnis aus: Was kann ich schon? Wie gut kann ich das schon?
Schüler:innen gestalten ihre Pausen
Im Mittagsband, das je nach Klassenstufe ein bis zwei Zeitstunden umfasst, öffnen sich neben dem Mittagessen zahlreiche Räume und Möglichkeiten für eine sinnstiftende Pausengestaltung. Dabei vertrauen wir darauf, dass die Lernenden die Pause gemäß ihren persönlichen Bedürfnissen individuell sinnvoll gestalten. Während einige die Pause als ganz individuellen Freiraum schätzen und sich in einer unserer Bibliotheken, auf einem der Sportplätze, in den offenen Ateliers, sowie Angeboten der Schulsozialarbeit aufhalten, nehmen viele Schüler:innen an den zahlreichen offenen Mittagsbandangeboten teil. Für die Jahrgänge 7 bis 10 gibt es z. B. täglich zehn offene dreißigminütige Angebote, die von Lehrkräften angeleitet werden. Wichtig für den Erfolg der Angebote ist die Balance zwischen Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, Bildungsangeboten und Lernberatungen, Entspannungsangeboten sowie kreativen Betätigungsfeldern. Die Möglichkeiten reichen von Yoga, Fußball, Ringen und Raufen über Berufs- und Lernberatungen sowie Angeboten zur Erweiterung der Digitalkompetenzen hin zu Tik-Tok-Tänzen, Karaoke, Klavierpausen, Kreativwerkstätten und Betätigungen in der Schülerfirma. Das Mittagsband ist damit auch ein Raum zum Verfolgen eigener Interessen sowie zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und wichtiger Bestandteil unserer gebundenen Ganztagsschule. Zugleich finden auch Pädagog:innen mitunter in den Ganztagsangeboten einen besonderen Raum, ihre persönlichen Leidenschaften zum Tragen zu bringen.
Schüler:innen gestalten ihre eigenen Konfliktlösungen
Seit dem Schuljahr 2023/2024 gehört ein Schüler:innenmediationsprojekt zum festen Bestandteil des gemeinsamen sozialen Lernens. Die Kinder und Jugendlichen selbst benötigen in hohem Maße Vertrauen in die Mediation, dass Gleichaltrige die Lösung von Konflikten ebenso und vielleicht sogar besser unterstützen können als Lehrkräfte. Die Mediator:innen brauchen Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit, um die Aufgabe der Konfliktlösung gut zu meistern. Dies wird in einer umfassenden Ausbildung durch einen Kooperationspartner der Schule gelernt und in der wöchentlich stattfindenden Arbeitsgemeinschaft vertieft. Durch jede einzelne erfolgreich durchgeführte Mediation erleben die Mediator:innen Selbstwirksamkeit und lernen, Konflikte zu reflektieren und gemeinsam Lösungen dafür zu entwickeln. Die Konfliktparteien fühlen nach einer gelungenen Mediation, dass ihre Probleme und Sorgen ernst genommen werden. Durch einen jährlichen Ausbildungsdurchgang für Schüler:innen, versprechen wir uns eine organische Entwicklung der Konfliktlösekompetenz in der Schülerschaft insgesamt, die sich positiv auf unser ganzes Schulklima und die Dialogkultur auswirkt.
Vertrauen als Gelingensbedingung und Ergebnis der Weiterentwicklung
Ganz so, wie die Lernkultur für unsere Kinder und Jugendlichen als angstfreier Raum gemeinsam gestaltet sein soll, muss das auch für die Schul- und Unterrichtsentwicklung gelten. So wird momentan in der Grundstufe ein sogenannter „Zukunftstag“ erprobt, wobei die Lernenden selbstständig Projekte in ihrer Umgebung durchführen; neben anderen Aktionen besuchten sie zum Beispiel Altenheime – unterstützt von ihren Lehrkräften als Lernbegleiter.
Vgl. ausführlicher: Linda Helbig, Beat Seemann, Patricia Soler, Clara Wengler: Ein Campus als offenes Feld. In: Lernende Schule 108/2024. Seite 26-29.
Weitere Informationen:
https://www.campus-hannah-hoech.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule: Geborgenheit und Gemeinschaft
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule
In der Peer Review unserer kritischen Freunde vom „Blick-über-den-Zaun“ im November 2023 wurden unsere Schüler*innen von den Beobachter*innen gefragt, welcher Begriff am ehesten für ihre Schule zutreffen würde. Die Grundstufenkinder an der „kleinen Anna“ antworteten mehrheitlich „Geborgenheit“, im Sekundarstufenteil an der „großen Anna“ wurde „Gemeinschaft“ genannt.
hier lesen
Geborgenheit und Gemeinschaft
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule
Karin Richter, Andreas Hanika
In der Peer Review unserer kritischen Freunde vom „Blick-über-den-Zaun“ im November 2023 wurden unsere Schüler*innen von den Beobachter*innen gefragt, welcher Begriff am ehesten für ihre Schule zutreffen würde. Die Grundstufenkinder an der „kleinen Anna“ antworteten mehrheitlich „Geborgenheit“, im Sekundarstufenteil an der „großen Anna“ wurde „Gemeinschaft“ genannt.
Woran liegt das? Betrachten wir Emil: Er macht gerade seinen mittleren Schulabschluss (MSA) an der „AEGS“ und hat dafür an beiden Standorten der Schule, der „Kleinen“ und der „Großen“ Anna gelernt, die immerhin 8 km voneinander entfernt liegen.
Wir gehen den Fragen nach: Was verbindet uns? Was trägt uns?
Kleine Anna
Als Emil an einem Samstag im September an der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule eingeschult wurde, kannte er sie schon ganz gut.
Er hatte bereits das benachbarte Montessori-Kinderhaus besucht; so sind ihm das Gebäude, der Hof und die Pädagogik samt der Materialien bereits vertraut. Seine Aufregung vor der „echten“ Schule hatte sich bereits am Ende seines letzten Kindergartenjahres gelegt, als er und alle mit ihm gemeinsam angemeldeten neuen Erstklässler*innen einen Vormittag lang zum Spielen, Basteln, Singen und Kennenlernen der Hort-Räume und des Schulhofes in der „Kleinen Anna“ zu Besuch waren. In der ersten Schulwoche vor der Einschulung war er dann bereits jeden Tag im „Hort“ (korrekt: „EFöB“) gewesen und hatte dort die anderen Erstklässler*innen seiner Klasse und seine Klassenerzieher*in kennen gelernt. An der Einschulung nahmen dann seine eigenen Klassenkamerad*innen aus den Jahrgängen 2 und 3 teil, die die ganze Woche für die Aufführung geübt hatten. Der Einstieg in die Gemeinschaft wurde also schon hier ganz leicht gemacht.
Im 1. Jahr seiner 123‑Zeit erlebte Emil dann das Lernen in der jahrgangsgemischten Gruppe. Zu Beginn stand ihm ein Pate zur Seite; und auch alle anderen „großen“ Zweit- und Drittklässler*innen kannten sich mit dem Material, den Abläufen in der Klasse und allem anderen bestens aus und halfen ihm – wenn nötig. Dass in seiner Gruppe auch noch mehrere Inklusionskinder lernten, fand er nicht bemerkenswert, so kannte er das ja bereits aus seiner Zeit im Kinderhaus. Toll fand er, dass auf diese Weise oft nicht nur seine beiden Lehrer*innen und ein(e) Erzieher*in, sondern auch noch eine Schulhelfer*in in der Klasse waren und ihm als Ansprechpartner*in und Lernbegleiter*in zur Verfügung standen. Ganz ehrlich: Wer hier in welcher Rolle arbeitete, wusste er nicht wirklich. Aber es war ihm auch egal. Nett waren sie alle, und offensichtlich verstanden sie sich auch sehr gut...
Besonders eindrucksvoll fand er die wöchentlich dargebotenen „Kosmischen Erzählungen“ von Maria Montessori und den „Klassenrat“, der von den Klassensprecher*innen der Klasse geleitet wurde.
Schon bald stellte Emil fest, dass er zwar zu den Jüngsten gehörte, inzwischen aber schon gut lesen konnte und deshalb auch immer wieder Aufgaben von den „Großen“ bearbeiten konnte. Besonders gern mochte er die Freiarbeit und da vor allem das Arbeiten mit den Montessori-Materialien.
Am Ende seines 2. Schuljahres traf Emil das erste Mal seine kleine Schwester Maja in „seiner“ Schule, sie schnupperte im Rahmen des „Kennenlerntages“ nun ihrerseits in die Schule hinein. Bislang hatte er es still genossen, als Schulkind so viel größer als sie zu sein und nicht mehr das benachbarte Montessori-Kinderhaus (1) zu besuchen. Doch ein bisschen stolz machte es Emil auch, dass seine kleine Schwester durch ihn als Geschwisterkind einen Platz an der „Kleinen Anna“ bereits sicher hat. Plätze sind begehrt und bereits zur 1. Klasse ist die Schule deutlich übernachgefragt, nicht nur im Zehlendorfer Kiez, sondern als montessori-profilierte Grundstufe einer Gemeinschaftsschule auch weit darüber hinaus.
Den Namen „Kleine Anna“ nahm Emil immer wieder mal wahr, denn manche Kinder erzählten von ihren Geschwistern, die bereits an der „Großen Anna“ sind. Und ein paar Mal im Schuljahr waren tatsächlich auch große Schüler*innen aus den Klassen 7–10 zum Vorlesen da oder als Praktikant*innen im Unterricht.
Im Lauf der nächsten zwei Jahre wurde Emil ein „Großer“ in der 123-Klasse. Er übernahm als Pate die Betreuung eines neuen Erstklässlerkindes, nahm als Klassensprecher an den Sitzungen des „Anna-Kids-Parlaments“ teil und erarbeitete ein erstes eigenes kleines „Portfolio“ zu einem Thema, das ihm besonders am Herzen lag. Er präsentierte es seiner Klasse, seinen Eltern und Freunden und war nun gut auf den Wechsel in die 456-Klasse vorbereitet.
In der neuen Klassenkonstellation lebte sich Emil dank des Patensystems schnell ein. Zwar hatte er jetzt mehr Fachunterricht und längere Schultage, aber dafür war er ja nun auch einer der „Großen“. Besondere Freude bereiteten Emil die Anna-Games, die fröhlichen Spiel-Sportfeste, die gemeinsam mit der „Großen Anna“ jeweils einmal im Sommer und im Winter stattfinden.
Spätestens hier wurde ihm klar, dass auch die „Großen“ aus den 78910er-Klassen nett und hilfsbereit sind und dass er nach der 6. Klasse an die Große Anna übergehen würde. Beim Kennenlerngespräch mit der Schulleitung durfte er Wünsche äußern und erhielt schließlich mit Romy und Anil zwei seiner Wunschfreund*innen als Klassenkamerad*innen an der Oberschule.
Die letzten Wochen an der Grundstufe fühlten sich irgendwie merkwürdig an: so groß und irgendwie schon „entwachsen“, aber doch in der Geborgenheit seiner Mitschüler und auch vom Klassenleitungsteam (2) noch wohlig umschlossen.
Große Anna
Als Emil an einem Dienstag im September schließlich an der Großen Anna eingeschult wurde, kannte er sie schon ganz gut. Ihm als Großen fiel auch der nun längere Schulweg nicht schwer; die Selbständigkeit mit dem Fahrrad oder mit den „Öffis“ zu fahren, hatte er ja bereits in der 6. Klasse gut trainiert. Mit Romy und Anil an seiner Seite und ebenfalls Paten fiel ihm die Eingewöhnung gar nicht so schwer. Die Älteren an seiner Tischgruppe erklärten ihm, dass der Themenzentrierte Unterricht (TZU) so ähnlich sei wie die Kosmische Erziehung an der Grundstufe zuvor: Ein großes Thema (3) wird mit sehr viel Zeit und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und neben wichtigen Grundkenntnissen, die die Lehrkräfte vermitteln, spezialisiert man sich selber auf einen Bereich, den man am interessantesten findet und erarbeitet dazu ein Lernprodukt. Dieses wird präsentiert.
Hier spürte Emil dann aber zunächst doch ein mulmiges Gefühl, als er als Fußballfan beim Thema Migration „nur“ ein Fußballplakat mit Informationen zu den Migrationshintergründen der Spieler seines Lieblingsvereins erstellt hatte. Durch die Möglichkeit, dieses nur Romy und Anil und zwei anderen aus der Klasse vorzustellen, fiel ihm die Präsentation dann aber leicht. Und als es später im Klassenraum hing, und er auch anderen viele Fragen beantwortete und diese rückmeldeten, dass sie es eine tolle Idee fanden, Migration einmal von der sportlichen Seite aus zu betrachten, wuchs er beträchtlich.
Fortan war auch die Herausforderung von Präsentationen vor Größeren und ganzen Gruppen kein Thema mehr.
Überrascht hatte Emil schon, dass die älteren 9er und die 10er, die Zensuren erhielten, diese zu keinem so großen Thema machten, man bekam sie eben. Irgendwie schien es beim Thema Bewertung genau wie an der Grundstufe weiterzugehen. Deutlich häufiger als fachliche Themen wurden Werte besprochen und beurteilt, die die ganze Persönlichkeit der Schüler*innen ausmachen: Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, Einsatz für die Klassengemeinschaft und gelebte Toleranz.
In seinen halbjährlichen Bilanzgesprächen ging es bei Emil zumeist auch um diese Themen und um die Frage, ob er seine Ziele des vergangenen Halbjahres verfolgt und erreicht hätte und welche er sich für die nächste Zeit setzen würde. Emils Eltern waren immer wieder überrascht, dass diese Gespräche so lang und intensiv waren und sich meist auch mehrere seiner drei Klassenlehrer*innen Zeit dafür nahmen.
In wenigen Wochen nun wird Emil sein MSA-Zeugnis erhalten und anschließend ein freiwilliges soziales Jahr antreten. Schon immer half Emil gern anderen, und er war nicht nur für Rufus, dem Jungen mit dem Downsyndrom in seiner Klasse, ein zugewandter Lern- und Spielpartner, sondern auch den Pädagog*innen der Kleinen Anna eine wertvolle Unterstützung in seinem Praktikum dort.
Am gleichen Tag wie für Emil findet auch Majas Abschlussfeier statt. Emils Schwester und ihren Eltern half bei der Entscheidung in der 8. Klasse die Jahrgangsstufe zu überspringen, die breite Jahrgangsmischung. Im gewohnten und sicheren Umfeld desselben Klassenverbandes bearbeitete sie von heute auf morgen nahezu mühelos den Stoff der Älteren und erzielte auch dort beachtliche Leistungen.
Gefragt, was sie am meisten vermissen wird, wenn sie im nächsten Schuljahr ein Auslandsjahr antreten wird, nannte sie die „Gemeinschaft“. Und sie sei glücklich an einer Schule lernen zu können, die dieses Wort sogar im Namen trägt.
(1) Die Kooperation mit dem Union-Hilfswerk, unter dessen Trägerschaft die KiTa läuft, funktioniert besonders gut.
(2) Klassenleiterin / Teamerin / Erzieher*in
(3) Halbjahresthemen sind u.a. Globalisierung, Revolutionen, Migration, Klimawandel.
Weitere Informationen:
https://aegs.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: Multiprofessionelle Teamarbeit
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule
Die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule erhielt 2024 aufgrund ihrer datenbasierter Schul- und Unterrichtsentwicklung in Verbindung mit einer außergewöhnlich positiv professionellen Bindung zwischen Lernenden und Pädagog*innen den Deutschen Schulpreis: „All Inn und eine Schule ohne Klassifizierung und Stigmatisierung!“ (Schulpreisjury)
Die Gelingensbedingungen für ein kohärentes Agieren eines multiprofessionellen Teams sind der Fokus dieses Beitrags.
hier lesen
Multiprofessionelle Teamarbeit
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule
Judith Bauch
Die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule erhielt 2024 aufgrund ihrer datenbasierter Schul- und Unterrichtsentwicklung in Verbindung mit einer außergewöhnlich positiv professionellen Bindung zwischen Lernenden und Pädagog*innen den Deutschen Schulpreis: „All Inn und eine Schule ohne Klassifizierung und Stigmatisierung!“ (Schulpreisjury)
Die Gelingensbedingungen für ein kohärentes Agieren eines multiprofessionellen Teams sind der Fokus dieses Beitrags.
Mit All Inn haben wir die Komplexität des Zusammenspiels der Konzeptelemente für das inklusive und individualisierte Lernen gekennzeichnet, die vom Kind her entwickelt wurden und kohärent ineinandergreifen:jahrgangsübergreifendes Lernen über drei Jahrgänge, thematisches, exemplarisches, projektorientiertes und kooperatives Lernen in Fächerverbünden, Lernen an anderen Orten, das Projekt Herausforderung und die soziale Verantwortung, eine Rhythmisierung von An- und Entspannung im gebundenen Ganztag, keine Notenpunkte und Zensuren bis Jahrgang 9, Ansprache aller mit Vornamen und „Du“, Selbstüberprüfung zum selbstgewählten Zeitpunkt statt Klassenarbeiten, und nicht zuletzt Gemeinschafts- und Demokratiebildung von Anfang an.
Die bereits 2008 entwickelten Säulen des Schulkonzeptes – unsere Philosophie – wurden in einer aufwachsenden, sich jährlich vergrößernden Schule von 104 zu 1050 Lernenden und von 12 zu 140 Pädagog*innen heute in die Köpfe und Herzen weitergegeben und modifiziert. „Die gemeinsame Philosophie motiviert die Beteiligten durch ein überzeugendes Ziel, das die Richtung weist.“ (1, S. 123.)
Systematische Schul- und Unterrichtsentwicklung waren nur möglich, weil vom Beginn an Teamstrukturen angelegt, umgesetzt und weiterentwickelt wurden.
Unsere Arbeit in einer komplexen Teamstruktur beruht auf folgenden Grundsätzen:
- Wir haben Vertrauen in die Arbeit des anderen und können unsere Kraft konzentriert einbringen.
- Wir arbeiten effektiv, indem wir dezentralisiert diskutieren und Gesamtkonferenzen in den Teams vor- und nachbereiten.
- Klarheit in der Struktur, den Inhalten, in der Kommunikation, in der Dokumentation führen zur Entlastung.
Die Eltern- und die Schüler*innenvertretung organisieren sich ebenfalls in Teams. Das ermöglicht konsequent Partizipation und Zusammenarbeit sowie eine effektive Zusammenarbeit zwischen den Schüler*innen, Eltern und dem Team.
Die Schule hat für ihr komplexes Teamsystem einen übersichtlichen Zeit- und Arbeitsplan sowie Aufgabenbeschreibungen entwickelt. Regelmäßige Evaluationen und Fortbildung der Teamleitungen führen zum Erleben der Teamsitzungen als sinnvoll genutzte Zeit, auch wenn sie oberhalb des Deputates liegen.
Die Hausteams – multiprofessionell
Die Jahrgänge 1–10 der Schule sind gedrittelt und räumlich in drei Häuser verteilt. Jede Kolleg*in jeglicher Profession ist einem Haus zugewiesen. So entsteht innerhalb der großen Schule für alle Geborgenheit durch Übersicht, Bezug und Beziehung. Hier finden organisatorische Besprechungen z. B. zu Schulhöhepunkten, Austausch zu pädagogischen Schulentwicklungsthemen (A-Woche), kollegiale Fallberatungen sowie kooperative Förderplanung (FBS-Woche; FBS=Fallbesprechung), aber auch die Möglichkeit sich im Lerngruppenteam abzustimmen (B-Woche), statt. Verwaltungsleiterin und Hausmeister sind bei Bedarf dabei.
Die Jahrgangsteams – Unterrichtsentwicklung und interne Mini-Fortbildungen
Auf der horizontalen Ebene sind unsere Jahrgangsteams angelegt: 1–3, 4–6, 7–10 und die gymnasiale Oberstufe 11–13 im Verbund mit der Elinor-Ostrom-Schule. Mitglieder dieser Teams sind vorrangig die Lehrkräfte. Sonder- und Sozialpädagog*innen ordnen sich zu. Die Stufenleitungen sind regelmäßig dabei und bringen Impulse in die Arbeit der Teams ein. Die Erzieher*innen bestimmen aus ihrer Mitte zwei Multiplikator*innen für die Teilnahme an den Teamsitzungen 1–3 und 4–6, sie berichten im Ganztagsteam über die Themen der Jahrgangsteams.
Die Jahrgangsteams arbeiten vorrangig an der Unterrichtsentwicklung mit selbstgewählten Zielen in Rücksprache mit der Schulleitung sowie an gesamtschulischen Unterrichtsentwicklungsthemen (z. B. Standardisierung der Lerninstrumente). In den Teams der Sek I und II liegt der Fokus stärker auf fachlichen Arbeitsgruppen. In allen Teams finden interne Mini-Fortbildungen statt. Das Jahrgangsteam trifft sich alle zwei Wochen gemeinsam. In der B-Woche kann an Arbeitsschwerpunkten in Kleingruppen gearbeitet werden.
Jedes Team wählt sich im 2-jährigen Rhythmus eine Teamleitung. Im Haus sind es je eine Lehrkraft und eine Erzieherin, im Jahrgangsteam eine Lehrkraft.
Kollegiumsrat – Herzstück des Systems
Hier treffen sich wöchentlich alle gewählten Teamleitungen mit allen Mitgliedern der Schulleitung, um sich gegenseitig zu informieren und zu beraten: zu den gemeinsamen Schulentwicklungsthemen, Themen aus den Teams und denen der Schulleitung. Hier schlägt der Puls der Schule. Themen werden auf den Tisch gepackt, Verantwortungen zur Lösungserarbeitung festgelegt und wieder zusammengeführt. Damit dies effizient passiert, trifft sich entweder der gesamte Kollegiumsrat oder in Hausleitungs- und Jahrgangsleitungsteam unterteilt.
Das Schulentwicklungsthema sowie das daraus resultierende Ziel wird zu Beginn des Schuljahres beschlossen. Dies kann vorab in den Teams erarbeitet, aber auch nachbesprochen werden. Im Anschluss schließe ich als Schulleiterin den Schulvertrag mit der Schulaufsicht ab, der das abbildet.
Manchmal müssen wir auf aktuelle Besonderheiten eingehen, Fäden wieder aufnehmen und neu priorisieren.
Die zeitlichen Kapazitäten für Teamsitzungen (je 60 min) innerhalb des rhythmisierten gebundenen Ganztages sind durch die Gestaltung eines gebundenen Freizeitangebotes durch überwiegend Externe und in der Mittelstufe durch das Mittagsband und das Prinzip des Raumwächters möglich. In der Oberstufe beginnt der Unterricht montags später.
Gelingensbedingungen sind die Bereitschaft des*r einzelnen Kolleg*in, sich einzubringen und teilzunehmen. Dies wird bereits beim Einstellungsgespräch thematisiert. Wird die Teamzeit nicht mehr als entlastende und bereichernde Zeit wahrgenommen, wird die Gestaltung des Teams überarbeitet. Das spiegelt unser Grundverständnis als lernendes System wider. Aktuell hat das Team 7–10 seine Arbeit evaluiert und die Teamstruktur neu erarbeitet.
Die strukturierte, Partizipation ermöglichende Teamarbeit soll dazu beitragen, dass sich Pädagog*innen unterstützt und wohl fühlen. Das ist die Voraussetzung für gute pädagogische Arbeit!
(1) Die Praxis der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule hat durch die Veröffentlichung von A. Sliwka und B. Klopscheine eindrucksvolle Bestätigung erfahren:
Anne Sliwka/ Britta Klopsch: Das lernende Schulsystem. Beltz. 2024.
Weitere Informationen:
https://wvh-gemeinschaftsschule.de/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Fritz-Karsen-Schule: Die Sache mit den Noten
Fritz-Karsen-Schule
Eigentlich gehört die notenfreie Beurteilung zum pädagogischen „Werkzeugkasten“ der Gemeinschaftsschule, insbesondere, wenn und weil jahrgangsübergreifend und inklusiv gearbeitet wird.
hier lesen
Die Sache mit den Noten
Fritz-Karsen-Schule
Robert Giese
Eigentlich gehört die notenfreie Beurteilung zum pädagogischen „Werkzeugkasten“ der Gemeinschaftsschule, insbesondere, wenn und weil jahrgangsübergreifend und inklusiv gearbeitet wird. In der FKS sind bis Jahrgang 6 auch Noten abgeschafft. In der Mittelstufe gibt es einige retardierende Momente, die der Einführung der Notenfreiheit entgegen stehen und (bisher) nicht ausgeräumt werden konnten.
Die Fritz-Karsen-Schule wurde 1948 als Einheitsschule gegründet – letzlich auf Initiative des alliierten Kontrollrates –, wurde dann „Schule besonderer pädagogischer Prägung“, schließlich Gesamtschule mit Grund- und Oberstufe und ist seit 2008 Gemeinschaftsschule. Mit dieser Geschichte ist sie die älteste Schule des gemeinsamen Lernens in Deutschland. „Der erste Leitsatz der Schule lautet: ‚Wir sind eine Schule für alle.‘ Darin steckt die wichtigste Vorgabe für die Schule. Die wichtigste Vorgabe sind die ihr anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – so, wie sie sind und nicht so, wie wir sie uns wünschen mögen. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, als einzelne, unverwechselbare Individuen ernst genommen zu werden. Sie haben ein Recht darauf, dass die Schule für sie da ist und nicht umgekehrt.“ So steht es im Schulprogramm und das ist tatsächlich der Maßstab an dem sich Entwicklungsvorhaben messen lassen müssen.
In der Grundstufe
Seit 2006 arbeitet die Schule im gebundenen Ganztagsbetrieb und ab 2007 wurden kontinuierlich junge Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen aufgenommen. Im selben Jahr haben Kolleg*innen der Grundstufe nach langen Diskussionen, vielen Fortbildungen und gründlicher Vorbereitung begonnen, im jahrgangsübergreifenden Lernen (JüL) zu arbeiten. Gleichzeitig wurde bis zum Ende des dritten Schujahres vollständig auf Noten verzichtet. Grundüberlegungen dafür waren: In JüL-Lerngruppen ist die Heterogenität noch ein Stück größer als im hergebrachten jahrgangsbezogenen Unterricht, insbesondere wenn auch noch der Inklusions-Anspruch eingelöst werden soll. Es ist erforderlich, jedes Kind auf seinem individuellen Weg in seinem eigenen Tempo zu begleiten. Das schloss auch ein, Lernfortschritte durch individualisierte Lernerfolgskontrollen zu dokumentieren und zu überprüfen anstatt in genormte Klassenarbeiten allen Lernenden zum selben Zeitpunkt dieselben Aufgaben zu stellen. Verbale Beurteilungen sind hier wesentlich zielführender als Noten nach genormten Maßstäben.
Interne Evaluationen und die Überprüfung der Schule durch die Schulinspektion ergaben, dass die Lernerfolge und Leistungsstände überdurchschnittlich gut waren. Die Inspektoren kamen zu dem Urteil, dass die Arbeitsweise vorbildlich für die Berliner Schule sei. Die jährlichen VERA 3-Tests – ungeliebt, weil dem pädagogischen Konzept diametral entgegenstehend – bestätigten jedoch die Erfolge.
Es war nur konsequent den nächsten Schritt zu gehen. 2012 beschloss die Schulkonferenz auf Antrag der Grundstufenkonferenz das Lernen in den Jahrgängen vier bis sechs jahrgangsübergreifend zu gestalten und gleichzeitig auf Noten zu verzichten. Dem waren zum Teil heftige Diskussionen vorausgegangen. Es gab Ankündigungen in dem Sinn: „Wenn ihr das macht gehe ich, gehen wir.“
Unsere Argumentationen: Noten sind weder objektiv noch reliabel noch valide und häufig demotivierend.
- Bewerten mehrere Kolleg*innen dieselbe Arbeit, gibt es unterschiedliche Noten, von 1 – 5 ist dann alles dabei (fehlende Objektivität). Die Experimente dazu sind bereits vor über 100 Jahren gemacht worden.
- Bewertet eine Lehrkraft dieselbe Arbeit einige Wochen später noch einmal, ist die Chance groß, dass eine andere Note unter der Arbeit steht (fehlende Reliabilität).
- Schüler*innen mit Schwierigkeiten in der deutschen Sprache versagen regelmäßig in Mathetests. Sie erhalten eine schlechte Mathenote wegen ihrer Schwäche in der deutschen Sprache (fehlende Validität).
- Eine Schülerin hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche – in einem Diktat (als die noch geschrieben wurden) macht sie 100 Fehler auf 100 Wörter. Nach einem Jahr intensiven Trainings macht sie nur noch 80 Fehler. Welche Note wird sie erhalten? Kaum motivierend.
Ein Schüler lernt sehr schnell und erhält regelmäßig Zusatzaufgaben. „Was wollen Sie denn immer von mir? Ich hab doch schon eine Eins.“
Wir waren überzeugend. Tatsächlich verließen uns lediglich eine Kollegin und zwei Familien.
In der Folge wurden Lernwege in den verschiedenen Fächern Mathematik, Deutsch, Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften entwickelt und schrittweise eingeführt. Jedes Kind lernt individualisiert. Lernen im Gleichschritt gehört der Vergangenheit an und die Zeugnisse sowie die Lernentwicklungsgespräche orientieren sich immer an der individuellen Bezugsnorm und sie werden verbal formuliert. Das hilft den Kindern und Eltern zu verstehen.
und in der Mittelstufe?
Ab Jahrgang sieben wird noch immer mittels Noten bewertet. Es gab Überlegungen, Lernhäuser einzurichten in denen die Jahrgänge 7–10 zu einem Team gehören sollten mit der Option, versuchsweise auf Noten zu verzichten und jahrgangsübergreifend zu arbeiten. Aufgrund von Corona brachen die Diskussionen ab. Anderes stand im Vordergrund. Wie so häufig, wurde der Wichtigkeit des Dringlichen die Dringlichkeit des Wichtigen geopfert.
Es wird weiter mit Noten gearbeitet obwohl viele Kolleg*innen die pädagogische Fragwürdigkeit sehen. Außerdem geben Noten Anlass, immer wieder die leidige Frage nach den Differenzierungs-Niveaus zu stellen – „Ist das nun eine G3 oder E4?“. Es gibt drei wesentliche Gründe, warum das bisher nicht geändert wurde:
- Der erste und wichtigste ist die auch von Gewerkschaften immer wieder kritisierte Arbeitsüberlastung. Verbale Bewertungen sind zwar aussagekräftiger und dauern aber einfach länger. Möglichkeiten der zeitlichen Entlastung gibt es kaum.
- Der zweite besteht darin, dass ca. die Hälfte der Schüler*innen aus anderen Grundschulen kommt. Diese sind meist seit Jahren an Noten gewöhnt. Hier macht sich die aus früheren Zeiten noch „mitgeschleppte“ unterschiedliche Zügigkeit in Grund- und Mittelstufe negativ bemerkbar. Die Schule will das ändern, der Bezirk sieht das (bisher) anders.
- Der dritte besteht darin, dass andere Aufgaben im Vordergrund stehen. In jeder Klasse lernen 3 bis 5 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für die individuelle Förderpläne gemeinsam mit den Eltern, Kindern, Klassenlehrer*innen sowie Sonderpädagog*innen erstellt und erfüllt werden. Das ist je nach individuellen Bedürfnissen sehr verschieden aufwendig.
Als nächste Schritte sind derzeit Entwicklungen geplant, um die Arbeitsweise aus JüL 4–6 fortzusetzen, die Schüler*innen stärker in die Verantwortung zu nehmen und Lernwege zu erarbeiten, die es den Schüler*innen ermöglichen wesentlich selbständiger zu arbeiten.
Und sicher wird dann die Diskussion um die Noten neu aufgenommen ...
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/3
Der Puzzle-Bär
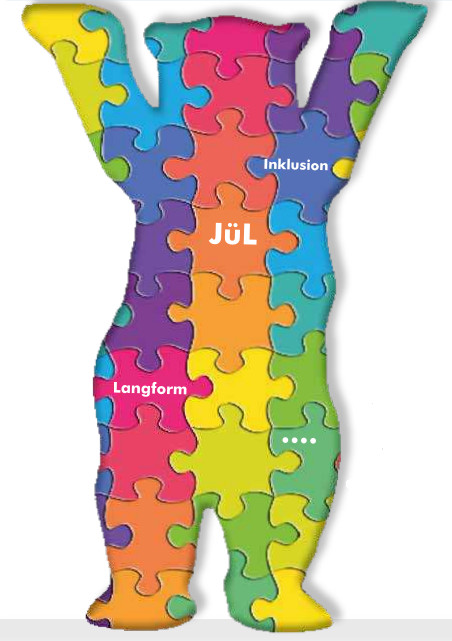
Der Puzzle-Bär
Wir Redaktionsmitglieder waren selbst überrascht, wie sich die Beiträge zu einem Gesamtbild der Berliner Gemeinschaftsschule zusammen setzen. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Fokusthema der einen Schule zum Set der pädgogischen Bausteine auch anderer Schulen gehört?
Geben Sie den Puzzleteilen Namen! Wir haben schon ’mal angefangen ...
Sie haben sich Gedanken über eine Vervollständigung gemacht?
Wir sind gespannt auf ihre Liste und würden uns freuen, wenn Sie sie uns schickten:
Sie können ihn auch herunterladen: Puzzle Bär .
